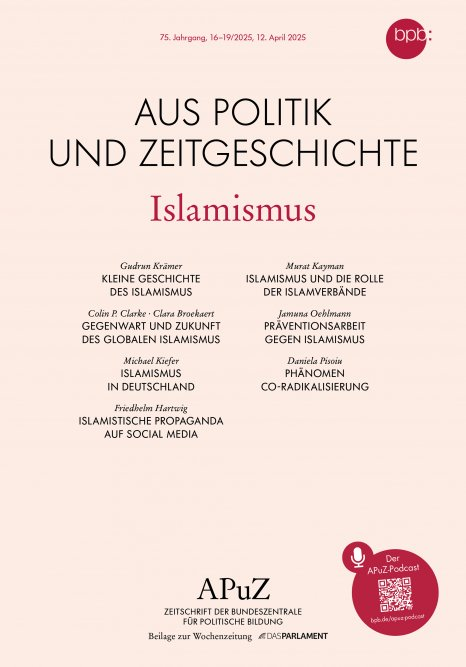Murat Kaymann ist Jurist und Publizist und war von 2014 bis 2017 Justiziar beim DITIB-Bundesverband. Er ist Mitgründer der Alhambra-Gesellschaft.
»Islamismus«, so die Definition des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, »ist eine Form des Extremismus. Unter Berufung auf den Islam zielt er auf die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ab und basiert auf der Überzeugung, dass der Islam Grundlage für das gesellschaftliche Leben und die politische Ordnung sein sollte. Islamismus postuliert die Existenz einer gottgewollten und allgemeingültigen Ordnung, die über den von Menschen gemachten gesellschaftlichen Regeln und Gesetzen steht. Damit stehen Islamisten insbesondere im Widerspruch zu den im Grundgesetz verankerten Grundsätzen der Volkssouveränität, der Trennung von Staat und Religion, der freien Meinungsäußerung und der allgemeinen Gleichberechtigung.«[1]
Als weiteres Element nennt das Bundesinnenministerium Antisemitismus als »einen wesentlichen gemeinsamen Nenner in der Ideologie des islamistischen Spektrums«. Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 gehe eine feindliche Gesinnung gegenüber jüdischen Menschen und Israel »inzwischen fast untrennbar Hand in Hand«. Islamistische Propaganda fördere nicht nur antisemitisches Gedankengut, sondern sie fordere auch dazu auf, »den Gedanken auch Taten folgen zu lassen«.
Nimmt man diese Definition zum Ausgangspunkt, dann reicht das Spektrum, in dem sich die Ideologie des Islamismus manifestiert, von der legalistischen Form eines Islamverständnisses, das religiöse Überzeugungen in konkrete Vorstellungen bezüglich der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und der politischen Staatsform überträgt, bis hin zum zur terroristischen Tat bereiten Extremismus.
Der Begriff des Islamismus ist in diesem Sinne unscharf und durch seine fließenden Grenzen zu bloßen Glaubensüberzeugungen, die von der Religionsfreiheit gedeckt sind, in seiner Handhabung im gesellschaftlichen Diskurs problematisch. Seine Verwendung ist stets mit dem Risiko behaftet, dass nicht mehr zwischen der Zugehörigkeit zur islamischen Glaubensgemeinschaft und der Identifikation mit islamistischen Überzeugungen differenziert wird. Wo hört das Muslim-Sein auf, und wo fängt die islamistische Einstellung an? Eine klare Unterscheidung ist dringend notwendig, damit eine Gleichsetzung von Muslimen und Islamisten vermieden wird.
Es wäre deshalb im Sinne aller Muslime – und damit im Interesse der Organisationen, die sich als muslimische Religionsgemeinschaften verstehen und den Anspruch erheben, Muslime zu vertreten –, hier für eine Klärung zu sorgen. Sie müssten es als ihre Aufgabe verstehen, ihre Glaubensvorstellungen deutlich und erkennbar von ideologischen, extremistischen Überzeugungen abzugrenzen und diesen Unterschied sowohl in der eigenen Gemeinschaft als auch in der nichtmuslimischen Gesellschaft zu kommunizieren.
Problemverdrängung
Ein solches Selbstverständnis ist bei den muslimischen Organisationen in Deutschland aber nicht zu beobachten. Das Gegenteil ist der Fall. Das Phänomen des Islamismus wird verdrängt. Bereits die Verwendung des Begriffs »Islamismus« wird häufig problematisiert und abgelehnt. Aus Sicht vieler muslimischer Verbände ist der Begriff schon deshalb zurückzuweisen, weil er im Wortstamm den Begriff »Islam« enthält. Islamistisch begründeter Extremismus sei als Missbrauch des Islams zu verstehen, der Islam könne als absolut wahre und richtige Glaubensgrundlage nicht die Quelle eines extremistischen Religionsverständnisses sein. In dieser Logik der muslimischen Verbände handelt es sich bei extremistischen Tätern niemals um »wahre Muslime«, sondern um Täter, die von anderen – nichtmuslimischen – Akteuren instrumentalisiert werden, um Muslime und den Islam in Gänze zu diskreditieren. Damit wird das Phänomen des islamistischen Extremismus vollständig externalisiert und außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs verortet.
Im Umkehrschluss begründet dieses Selbstverständnis die Annahme vieler muslimischer Organisationen, ihr Glaubensverständnis und ihre Glaubenspraxis – mitsamt ihrer institutionalisierten Arbeit, ihren organisatorischen Strukturen und den von ihnen vermittelten Inhalten und Grundüberzeugungen – seien der beste Gegenentwurf und die wirksamste Strategie gegen Radikalisierungstendenzen. Häufig verstehen sie schon ihre bloße Existenz als Bollwerk gegen jeden Extremismus. Darüber hinausgehende Bestrebungen der Bekämpfung extremistischer Ideologien oder gar eine als solche bezeichnete Strategie der »Extremismusprävention« haben aus dieser Sicht innerhalb der muslimischen Organisationen keinen Platz, da allein die Notwendigkeit einer Extremismusprävention den Vorwurf beinhalte, muslimische Gemeinschaften seien anfällig oder gar die Quelle für extremistische Ideologien und Taten.
Gegen ein positives Selbstbild ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es entbehrt jedoch angesichts der tatsächlichen Zustände innerhalb der muslimischen Gemeinschaften jeder Grundlage und Glaubwürdigkeit; jegliche Verantwortung für islamistische Entwicklungen zurückzuweisen, zeugt von Realitätsverweigerung. Mehr noch: Die Ignoranz gegenüber extremistischen Inhalten in den – realen und virtuellen – muslimischen Sozialräumen führt zu einer immer deutlicher wahrnehmbaren Wirksamkeit islamistischer Einflüsse auf junge Musliminnen und Muslime. Denn die islamistischen Propagandisten bleiben – insbesondere in den Onlinemedien – in der von ihnen eingenommenen Rolle der vermeintlich authentischen und kompromisslosen religiösen Autorität konkurrenzlos. Ihre Erzählung einer wahrhaftigen Frömmigkeit und ihre Ableitung weltlicher Konsequenzen aus dem von ihnen angebotenen ideologischen Islamverständnis bleiben als Wahrheitsanspruch unwidersprochen. Ihre Deutung, wonach mit der Thematisierung des Phänomens Islamismus keine extremistische Ideologie beschrieben werde, sondern diese als Waffe zur Abwertung des einzig wahren, des »objektiven Islam« eingesetzt werde, erfährt von den muslimischen Verbänden keinen Widerspruch. Damit aber verfestigt sich die islamistische Erzählung, wonach die nichtmuslimische Gesellschaft in ihrem Verhältnis zur muslimischen Gemeinschaft kategorisch muslimfeindlich sei – und eine dergestalt von außen bedrohte muslimische Gemeinschaft sich zwingend gegen ihre Feinde zur Wehr setzen müsse.
Identitätskonstruktionen
Diese konfrontative Sicht auf muslimische Existenz in Deutschland bildet gegenwärtig ein wirkmächtiges Fundament muslimischer Identitätskonstruktion und beeinflusst massiv das Selbstbild und die Selbstverortung junger Musliminnen und Muslime. Ihnen wird suggeriert, dass ihr muslimisches Dasein letztlich nur im Widerstand und im Konflikt zur nichtmuslimischen deutschen Gesellschaft möglich sei.
Daran haben auch die muslimischen Organisationen ihren Anteil, denen in diesem Zusammenhang nicht nur pflichtwidriges Unterlassen vorzuwerfen ist. Es ist nicht nur ihre Untätigkeit und ihre Passivität im Hinblick auf dieses konfrontative muslimische Identitätsangebot, sondern auch ihr aktives Handeln, das islamistische Tendenzen innerhalb der muslimischen Gemeinschaften fördert – und damit auch die potenzielle Radikalisierung insbesondere junger Musliminnen und Muslime.
Bei genauerer Betrachtung der wichtigsten muslimischen Verbände ist festzustellen, dass diese – bei allen sonst vorhandenen inhaltlichen Unterschieden – im Hinblick auf ihr Verhältnis zur hiesigen Gesellschaft übereinstimmende Haltungen und Sichtweisen erkennen lassen. Diese sind im Wesentlichen geprägt durch die Kontinuität ihrer »Fremdheitserzählungen«, wonach muslimische Existenz in Deutschland nicht für diese und mit dieser Gesellschaft gedacht wird, sondern im besten Fall als muslimische Enklave, als muslimische Diaspora in der deutschen Fremde. Im schlechtesten Fall sehen sich die Verbände im Widerstand zur hiesigen Gesellschaftsordnung, die in ihrer freiheitlichen, pluralistischen Prägung als unvereinbar mit muslimischen Glaubensvorstellungen begriffen wird.
Bei der DITIB etwa, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, resultiert die Fremdheitserzählung aus dem Selbstverständnis, als Ableger der türkischen Religionsbehörde in Deutschland für den Erhalt der nationalen, sprachlichen und kulturellen Identität der türkeistämmigen Nachfahren der ersten »Gastarbeitergeneration« zuständig zu sein. Die religiösen Dienstleistungen des Verbandes werden vor allem als Instrument zur Förderung des türkischen Spracherhalts und der Kulturpflege verstanden.
Bei der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG) manifestiert sich die ideologische Prägung und die Verankerung der eigenen institutionellen Wurzeln im islamistischen Milieu der türkischen Politik im Namen, im Daseinszweck und in der ideologischen Ausrichtung auf ihre Gründerfigur Necmettin Erbakan, dessen islamistisches Weltbild bis heute die Basis des Verbandes entscheidend prägt. Eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaftsordnung steht im Widerspruch zur Ideologie Erbakans.
Im Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) wiederum wird die dem Verband zugeschriebene Eigenschaft, Religionsgemeinschaft zu sein, im Wesentlichen durch die ATIB vermittelt, die Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa. Diese wird von den Verfassungsschutzbehörden der rechtsextremistischen türkischen Bewegung der Grauen Wölfe (»Ülkücü«-Bewegung) zugerechnet.[3] ATIB gehört seit den späten 1980er Jahren zu den Gründungsmitgliedern des ZMD und ist geprägt durch eine nationalistische, völkische und pantürkische Ideologie. Bis zu ihrem Ausschluss Anfang 2022 gehörte auch die Deutsche Muslimische Gemeinschaft (DMG) zu den einflussreichsten (Gründungs-)Mitgliedern des ZMD. Die DMG wird seit vielen Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet und als »wichtigste und zentrale Organisation« der Anhänger der Muslimbruderschaft in Deutschland betrachtet.[4]
Diese zahlenmäßig größten und das öffentliche Bild der Muslime in Deutschland bisher am stärksten prägenden Verbände weisen eine ideologische Kontinuität auf, in der die muslimische Existenz in Deutschland als eine von außen bedrohte Wagenburg, als eine muslimische Festung, umgeben von einer nichtmuslimischen Gesellschaft, charakterisiert wird. Ihr Religionsverständnis und damit auch ihr institutionelles Selbstverständnis ist geprägt von dem Wunsch nach Bewahrung und Verteidigung dieser muslimischen Existenz gegenüber einem mehrheitlich nichtmuslimischen Umfeld. Der Lebensort Deutschland war, ist und bleibt für sie dauerhaft »Fremde«.
Perpetuierung der Selbstentfremdung
Diese bewusste und durch jeweils unterschiedliche ideologische – nationalistische, ethnische, islamistische – Einflüsse dominierte Selbstentfremdung steht vor der Herausforderung, ihre Überzeugungs- und Anziehungskraft für die nachfolgenden muslimischen Generationen erhalten zu müssen. Und genau hier öffnet sich die Flanke der muslimischen Verbände: Sie werden anschlussfähig für explizit islamistische Erzählungen und leisten so einer islamistischen Radikalisierung von Musliminnen und Muslimen Vorschub. Ihr Angebot einer zur Identität geronnenen Glaubenszugehörigkeit erreicht junge Muslime zwangsläufig in Konkurrenz zu ihrer konkreten Lebenserfahrung in einer freien und demokratischen Gesellschaft.
Dies geschieht in positiver wie in negativer Hinsicht: Der negative Appell konzentriert sich auf die Diskriminierungs- und Benachteiligungserfahrungen junger Musliminnen und Muslime. Die deutsche Gesellschaft wird als muslimfeindliches Milieu beschrieben. Die Benachteiligung von Muslimen ist hier weniger ein rechtliches oder soziales Problem, das im Bündnis mit den nichtmuslimischen demokratischen Kräften in dieser Gesellschaft überwunden werden könnte. Sie wird vielmehr als wesenstypische, unveränderbare, quasi schicksalhafte Eigenschaft der deutschen Gesellschaft dargestellt, wobei »deutsch« als Synonym für »muslimfeindlich« oder »unislamisch« verstanden wird. Muslimische Religiosität muss in diesem Verständnis gegen »die Deutschen« verteidigt und bewahrt werden. Dieser Aufgabe ist das muslimische Individuum jedoch allein nicht gewachsen. Es braucht den Rückhalt und die Stärke des muslimischen Kollektivs. An dieser Stelle setzt die – aus der Binnenperspektive betrachtet – positive Erzählung an. In dieser wird die eigene muslimische Wir-Gruppe als eine der deutschen und damit als nichtmuslimisch verstandenen Gesellschaft überlegene Gemeinschaft beschrieben. Diese Gemeinschaft wird im muslimischen Selbstverständnis als eine in sozialer, ethisch-moralischer und sittlicher Hinsicht höherwertigere idealisiert.
Die Religion als Quelle eines absoluten Wahrheitsanspruchs sichert hier den behaupteten Überlegenheitsanspruch gegen jedwede individuelle Infragestellung ab. Denn die eigenen muslimischen Traditionen, Handlungsanweisungen, religionspraktischen Normen und Rituale kollidieren dort, wo sie als restriktiv empfunden werden – oder es tatsächlich sind –, mit den Freiheitsräumen der säkularen Gesellschaft und ihrem Anspruch auf Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Lebensentwürfe und Selbstverständnisse innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft.
Dieser Konflikt befördert damit jene Dynamiken, die die Überhöhung der eigenen muslimischen Gemeinschaft bis zu dem Punkt steigern, an dem die vermeintliche äußere Bedrohung durch die nichtmuslimische Gesellschaft nicht mehr nur erduldet werden kann, sondern aktiv bekämpft werden muss. Dort, wo die muslimischen Überlegenheitserzählungen gefestigt sind, wo sie perpetuiert und verinnerlicht werden, wird der Weg von der isolierend wirkenden Selbstentfremdung hin zur als Notwendigkeit empfundenen extremistischen Tat immer kürzer.
Die Problematik der muslimischen Verbände liegt also nicht in einer expliziten Feindseligkeit gegenüber der nichtmuslimischen Gesellschaft oder einer ausdrücklichen Gewaltlegitimation; zur Gewalt rufen sie ja nicht auf, und sie zeigen auch keine Bestrebungen, die unmittelbar auf die Überwindung der demokratischen Gesellschafts- und Staatsordnung gerichtet sind. Aber sie bereiten das ideologische Feld, auf dem extremistische Ideologien leichter gedeihen können, und setzen diesem Nährboden keine muslimische Selbstwahrnehmung entgegen, auf deren Basis eine fruchtbare Hinwendung zur nichtmuslimischen Gesellschaft gelingen könnte. Die Vorstellung einer hybriden Identität, in der die muslimische Facette mit der Zugehörigkeit zur und dem Einsatz für die gesamte deutsche Gesellschaft verwoben ist, wird innerhalb der muslimischen Verbände mehr oder weniger ausdrücklich, in jedem Fall aber konkludent zurückgewiesen. Die Existenz als »deutscher Muslim«, die Vorstellung eines »deutschen Islam« gilt den Verbänden als Oxymoron.
Vor diesem Hintergrund kann und will es den muslimischen Verbänden nicht gelingen, zu formulieren oder gar vorzuleben, wie ein Engagement zum Wohle der gesamten Gesellschaft, wie ein positives Verhältnis zu den pluralistischen, freiheitlichen Grundsäulen dieser Gesellschaft und eine gedeihliche Identifikation mit der deutschen Bevölkerung als eigene, ausdrücklich muslimische Haltung aussehen könnte.
Orthodoxie und Islamismus
Wie könnte ein muslimisch motivierter Einsatz zum Gelingen des Zusammenlebens in einer vielfältigen Gesellschaft ausgestaltet sein? Auf diese Frage haben muslimische Verbände bis heute keine Antwort gefunden, und sie zeigen auch keinerlei Bestrebungen, ihr Glaubensverständnis und die Paradigmen ihres gemeindlichen Lebens in diesem Sinne zu konkretisieren.
Denn eine solche Orientierung würde voraussetzen, dass sie sich mit den historischen und traditionellen Beständen ihrer Glaubenswelt auseinandersetzen und kritisch bewerten, welche Grundwerte der muslimischen Orthodoxie und der historischen theologischen Gelehrsamkeit einem gleichberechtigten Zusammenleben mit nichtmuslimischen Gruppen im Wege stehen. Sie müssten sich kritisch mit den misogynen, homophoben, antisemitischen, antichristlichen, den universellen Menschenrechten entgegenstehenden Inhalten ihrer historischen religiösen Wissensbestände auseinandersetzen und mit Anspruch auf Ernsthaftigkeit – als tatsächliche und nicht nur behauptete Religionsgemeinschaften – aktualisierte religiöse Wahrheiten generieren. Stattdessen beschränken sie sich auf die Bewahrung religiöser Auslegungsergebnisse, die für eine prämoderne Gesellschaft, für eine homogene Gemeinschaft entwickelt wurden und die auf der konfrontativen, auf Dominanz gegenüber anderen Gruppen ausgerichteten Idee einer Staats- und Gesellschaftsordnung von und für Muslime beruhen.
Dieser offensichtliche Konflikt wird jedoch nicht zum Anlass genommen, solche Auslegungsergebnisse als Produkte ihrer Zeit zu betrachten und sie für die Lebensbedingungen der Gegenwart zu erneuern. Die Forderung einer solchen Erneuerung des eigenen Glaubensverständnisses und nach innermuslimischer Meinungsvielfalt, die es in dieser Frage ja durchaus gibt, wird vielmehr als unzulässiger Akt der Glaubensrelativierung und als anmaßende, böswillige Schwächung einer vermeintlich überzeitlichen Frömmigkeit auf der Grundlage eines »objektiven Islam« delegitimiert.
Dieses Narrativ der muslimischen Verbände, sie seien die Bewahrer und Verteidiger eines »objektiven Islam« im Sinne einer Religion, die in der Vergangenheit religiöse Wahrheiten formuliert hat, die in unserer heutigen Zeit der Diskussion und Meinungsvielfalt innerhalb der muslimischen Gemeinschaften entzogen seien und lediglich reproduziert und nachgeahmt werden dürften, ist kein rein religionstheoretisches oder akademisches Problem. Es ist der Anknüpfungspunkt für den Anspruch des islamistischen Extremismus, eben keine extremistische Ideologie, sondern authentische, puristische Glaubenstreue zu sein.
Religiöse Ambiguität abzulehnen und die Reflexion und Relativierung historischer Auslegungen der überlieferten Glaubensquellen als unzulässig zu betrachten, schließt die individuelle Wahrheitsfindung in religiösen Fragen aus. Ein individuelles muslimisches Nachdenken über die Frage, was religiöse Normen und Rituale für die eigene Lebenswirklichkeit bedeuten – ob die historischen Ergebnisse der islamischen Theologie auch heute noch anwendbar und praktizierbar sind, ob sie als veraltet zu betrachten sind, ob ihnen womöglich ausdrücklich widersprochen werden muss, weil sie das gleichberechtigte Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft verhindern –, wird gerade durch die muslimischen Verbände zurückgewiesen. Denn ein solcher pluraler Ansatz in der Diskussion über die religiösen Grundbedingungen der muslimischen Existenz in Deutschland wird von ihnen als Infragestellung ihrer für sich beanspruchten religiösen Autorität begriffen. Die Definitionshoheit darüber, was muslimisches Leben in der deutschen Gesellschaft sein soll, wird durch die Verbände monopolisiert.
Diese Denk- und Glaubensmuster weisen eine bedenkliche Nähe zu den Glaubensvorstellungen radikaler Gruppen auf. Deren in den sozialen Medien gerade jungen Musliminnen und Muslimen vermittelte islamistische Sicht auf die hiesige Gesellschaft wird von der Prämisse getragen, dass ihr Glaube nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei, weil der deutsche Staat und diese »ungläubige« Gesellschaft von ihnen erwarteten, dass sie sich assimilieren und damit ihren muslimischen Glauben aufgeben.
Für Islamisten gründen religiöse Kernaussagen auf »objektiven Erkenntnissen«, die als absolut wahr aufgefasst werden und über die es niemals zwei Meinungen geben kann. Die Gewalt extremistischen Denkens resultiert aus der fehlenden Bereitschaft, Mehrdeutigkeit und Ambiguität in der Deutung religiöser Inhalte zuzulassen. Für diese Islamisten existiert ein kohärentes Denksystem, in dem kein Platz ist für Widersprüche und von ihren Glaubenssätzen abweichende Lebensentwürfe. Die Überzeugung von einer einzig wahren, einer objektiven, einer allein richtigen Glaubenswirklichkeit ebnet den Weg in die Gewaltbereitschaft, weil neben dieser vermeintlich objektiven religiösen Wirklichkeit alle anderen subjektiven Auffassungen keine Existenzberechtigung beanspruchen dürfen.
Letztendlich wird muslimische Religiosität damit zu einer identitären Zugehörigkeit, über deren Geltungsanspruch andere, nämlich religiöse Autoritäten, entscheiden – und löst sich so von der individuellen Aneignung durch den Einzelnen. Muslimische Glaubensüberzeugung entfernt sich damit von einer Haltung des Gewissens und der inneren Einstellung und wird zu einem Zugehörigkeitsmerkmal, das von äußeren Kriterien abhängig ist.
Von dieser Dynamik sind zunehmend auch die gesellschaftlichen Diskurse betroffen. So war nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 vielfach zu beobachten, dass die Erwartung einer eindeutigen antiisraelischen und antijüdischen Parteinahme als identitärer Anker fungierte. Die Haltung nicht nur zum Nahostkonflikt generell, sondern auch konkret zum Terroranschlag der Hamas entwickelte sich zu einer Loyalitätsprüfung für die Zugehörigkeit zu einem vermeintlichen muslimischen Kollektiv. Islamistische Gruppierungen gaben eine Deutung der Terroranschläge im Sinne eines »legitimen Widerstandes« vor, der sich insbesondere junge Musliminnen und Muslime nicht entziehen konnten, ohne ihre Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft angezweifelt zu sehen. Wie wirkmächtig diese radikalisierenden Tendenzen mittlerweile bis tief in die etablierten Strukturen der muslimischen Organisationen hineinreichen, war an den zögerlichen und widerwilligen Reaktionen der muslimischen Verbände zu erkennen, die bis zum heutigen Tag die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnen können, ohne den Protest der eigenen Basis befürchten zu müssen.
Was tun?
Dieser Konflikt ist auf absehbare Zeit nicht zu lösen. Die muslimischen Verbände sind zu sehr von der von ihnen selbst entworfenen religiösen Identitätskonstruktion abhängig. Sinn und Zweck ihrer gesamten Existenz – und damit auch jede Facette ihres praktischen Wirkens – sind darauf ausgerichtet, muslimische Religiosität als Gegenentwurf zur Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft zu formulieren. Ihr einziges öffentliches Thema ist die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Muslimfeindlichkeit – jenem Thema also, mit dem die eigene Erzählung von der Konfrontation mit der nichtmuslimischen Gesellschaft perpetuiert werden kann. Andere öffentliche, gesamtgesellschaftliche Themen existieren in der verbandlichen Realität de facto nicht. Überaus anschaulich wurde dies am Verhalten – oder präziser formuliert: am Nicht-Verhalten – der muslimischen Verbände im Vorfeld der jüngsten Bundestagswahl: Keiner der Verbände hielt es für nötig, eine öffentliche Position zur AfD zu formulieren. Die generelle Gefährdung der Demokratie in Deutschland ist für sie kein Thema, eine Gefahr erkennen sie lediglich in ihrer potenziell muslimfeindlichen Dimension. Sie sind nicht in der Lage, eine umfassendere Perspektive zur demokratischen Zukunft dieses Landes zu formulieren, weil sie sich von dieser Zukunft nicht betroffen fühlen; ein Interesse an den demokratischen Beteiligungs- und Willensbildungsprozessen ist insoweit nahezu nicht existent. Stattdessen organisieren muslimische Verbände Brunnenbauprojekte, Lebensmittelhilfen oder Aufbauprojekte im Ausland, überwiegend in fernen asiatischen oder afrikanischen Ländern. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, nach Linderung der Armut oder nach karitativem Engagement für eine Zielgruppe in Deutschland stellt sich ihnen nicht – denn die Realität dieser Gesellschaft findet in den Räumen der muslimischen Verbände nicht statt.
Dies ist vielleicht der größte Unterschied zwischen den muslimischen Verbänden und den etablierten Kirchen in Deutschland. Die Verbände stellen den Anspruch, als Religionsgemeinschaften behandelt und als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden. Diese Statusfragen stellen für sie jedoch lediglich rechtstheoretische Begrifflichkeiten dar, mit denen sie einen sozialen Geltungsanspruch durchsetzen wollen, den sie inhaltlich nicht auszufüllen in der Lage sind. Ihnen fehlt bis heute eine Vorstellung davon, was ein solcher Status für sie konkret bedeutet und wie sie ihn mit Blick auf die Gesamtgesellschaft praktisch ausfüllen könnten. In welcher Weise soll eine muslimische Religionsgemeinschaft in die gesamte Gesellschaft hineinwirken? Diese Frage ist in der muslimischen Verbandslandschaft derzeit kein Diskussionsgegenstand. Denn dieser verfassungsrechtliche Status dient den muslimischen Verbänden im oben beschriebenen identitären, konfrontativen Selbstverständnis lediglich dazu, die staatliche Sphäre zur Kooperation zu verpflichten, um in einer solchen Kooperation – etwa im Bereich des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen oder der universitären Theologie – das eigene Glaubensverständnis verstetigen zu können. Es ist in letzter Konsequenz kein gemeinsam gestaltendes Kooperationsverständnis, sondern ein defensives.
Zwingend erforderlich ist eine klare Positionierung muslimischer Verbände zu der Frage, welches Verhältnis Musliminnen und Muslime zu der hiesigen Gesellschaft aufbauen können und sollen. Wie kann eine muslimische Lebensführung die Sphäre der eigenen muslimischen Vergemeinschaftung verlassen, in die gesamte Gesellschaft hineinwirken und dabei von der Intention getragen sein, das Gemeinwohl zu fördern? Wenn der demokratische Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, wie der frühere Bundesverfassungsrichter und Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang Böckenförde einst formulierte, welche Voraussetzungen des Gelingens können dann Musliminnen und Muslime zu diesem sozialen Kapital eines demokratischen Staates beitragen?
Diese Fragen gehen über eine staatbürgerschaftliche Zugehörigkeit hinaus. Sie reichen weiter als die Einforderung sozialer Teilhabeansprüche. Sie verlangen eine Antwort darauf, wie ein muslimischer Beitrag zum Gelingen eines demokratischen Staates aussehen kann. Diese Antwort kann keine Regierung, keine öffentliche Debatte den muslimischen Verbänden diktieren. Sie müssen diese Antwort schon aus eigenem Antrieb und aus einer selbst empfundenen Verantwortung für diese Gesellschaft formulieren. Beginnen könnten sie damit, der islamistischen Predigt, wonach muslimisches Leben nur im Kampf gegen diese Gesellschaft durchgesetzt werden kann, laut zu widersprechen.
Fussnoten
[1] Bundesministerium des Innern und für Heimat, Islamismus http://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/extremismus/islamismus-und-salafismus/islamismus-und-salafismus-node.html.
[2] Ebd.
[3] Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutzbericht 2023, Berlin 2024, S. 281
[4] Vgl. ebd., S. 253.
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz “CC BY-NC-ND 3.0 DE — Namensnennung — Nicht-kommerziell — Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland” veröffentlicht. Autor: Murat Kayman für Aus Politik und Zeitgeschichte/bpb.de