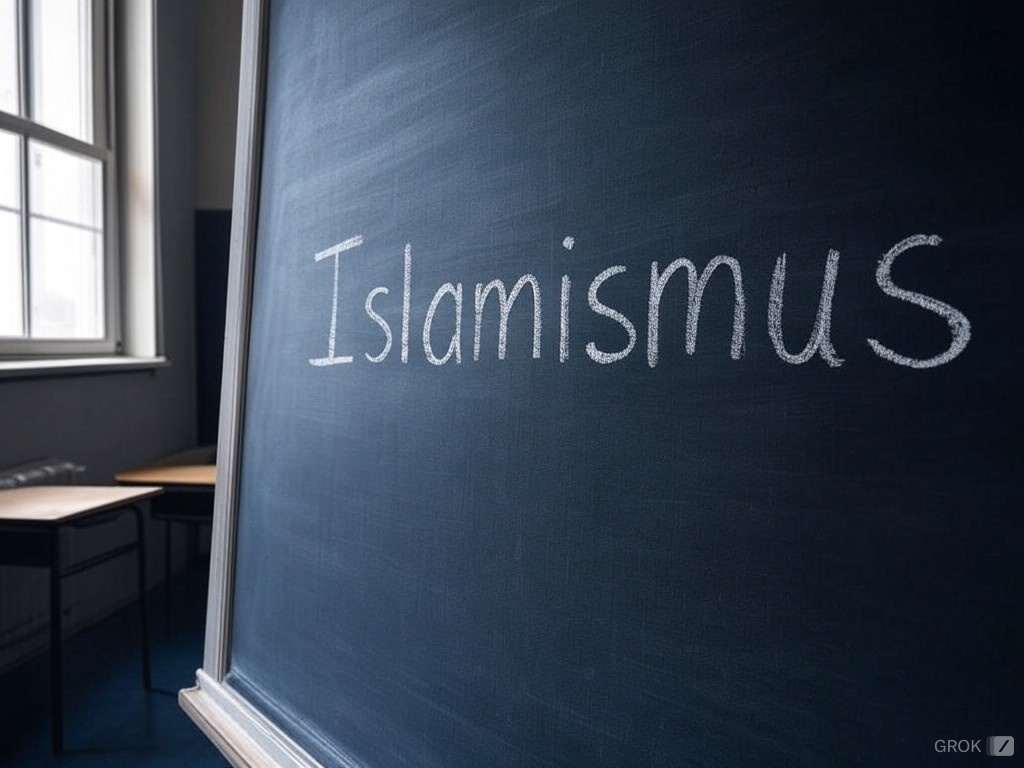Einleitung und Fragestellung
Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist der Begriff “Islamismus” in der öffentlichen wie wissenschaftlichen Debatte kontinuierlich präsent. Häufig wird er mit Bezeichnungen wie “islamischer Fundamentalismus”, “Jihadismus” oder “radikale Muslime” synonym verwendet. Doch was damit genau gemeint ist, bleibt häufig unklar. Meist sollen mit “Islamismus” solche fanatischen und gewalttätigen Gruppen mit terroristischer Ausrichtung begrifflich erfasst werden, die sich auf den Islam beziehen. Diese Auffassung ignoriert, dass es sehr wohl auch Islamisten gibt, die nicht in der Gewaltanwendung ihr vorrangiges politisches Instrument sehen. Mit der einseitigen Fixierung auf diesen Handlungsstil beraubt man sich einer wichtigen Erkenntnis: Islamistische Auffassungen sind aus demokratietheoretischer Sicht grundsätzlich problematisch – unabhängig von einer latent oder manifest vorhandenen Gewaltbereitschaft.
Definition von Islamismus allgemein
“Islamismus“ist eine Sammelbezeichnung für alle politischen Auffassungen und Handlungen, die im Namen des Islam die Errichtung einer allein religiös legitimierten Gesellschafts- und Staatsordnung anstreben. Der ideologische Ursprung der gemeinten Bewegung liegt in inner-islamischen Reformbestrebungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die organisatorische Wurzel ist in der 1928 in Ägypten gegründeten “Muslimbruderschaft” zu sehen. Allen späteren Strömungen war und ist die Absicht eigen, den Islam nicht nur zur verbindlichen Leitlinie für das individuelle, sondern auch für das gesellschaftliche Leben zu machen. Dies bedeutet: Religion und Staat sollen nicht mehr getrennt und der Islam institutionell verankert sein. Damit einher geht die Ablehnung der Prinzipien von Individualität, Menschenrechten, Pluralismus, Säkularität und Volkssouveränität.
Handlungsstile zwischen Gewalt und Politik
Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung sind keineswegs alle Islamisten grundsätzlich gewaltorientiert bzw. zu terroristischen Handlungen bereit. Idealtypisch lassen sich folgende vier Handlungsstile unterscheiden, wobei sie wiederum zwei Obergruppen zugeordnet werden können: Gemeint sind damit gewaltgeneigte und reformorientierte Strömungen, also ein “jihadistischer” und “institutioneller Islamismus” (Bassam Tibi). Für den letztgenannten Bereich wären etwa Parteien zu nennen, welche auf parlamentarischem Weg nach erfolgreichen Wahlen wirken wollen. Islamisten, die mehr auf die Sozialarbeit ausgerichtet sind, geht es um die Gewinnung von Anhängern durch Präsenz im Alltagsleben. Bei den gewaltgeneigten bis terroristischen Gruppen im Islamismus unterscheidet man zwischen denen, die lediglich in ihren Heimatländern Gewalttaten begehen, und denen, die auch in anderen Ländern solche Taten beabsichtigen. In der Realität mischen sich mitunter mehrere dieser Handlungsstile mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Verhältnis Islam und Islamismus
Wie sich Islam und Islamismus zueinander verhalten, darüber gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen: Die eine Auffassung geht davon aus, dass kaum ein Unterschied zwischen Islam und Islamismus bestehe, da der Islam sich als Religion auch auf die Lebensweise und damit ebenso auf die Politik beziehe. Diese Sicht erklärt letztendlich jeden Muslim zum Islamisten, was weder der Realität in den westlichen noch in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften entspricht. Die andere Auffassung postuliert, dass Islamisten den Islam lediglich im eigenen Interesse instrumentalisieren und daher kein Zusammenhang zwischen Islam und Islamismus bestehe. Diese Deutung unterschlägt den grundlegenden Stellenwert der Berufung auf den Islam und der Identitätsbildung über diese Religion im Islamismus. Demgegenüber soll hier für die Auffassung von der “Islamismuskompatibilität des Islam” (Armin Pfahl-Traughber) plädiert werden, wonach die Islamisten zwar nicht die einzige, aber eine mögliche Deutung des Islam vertreten.
Anknüpfungspunkte in Basis und Geschichte des Islam
Dazu verweisen sie auf Aussagen im Koran und die Geschichte dieser Religion: Im Koran finden sich Aussagen, die einen Absolutheitsanspruch für den eigenen Glauben und Ausgrenzungstendenzen gegenüber Andersgläubigen zum Ausdruck bringen. Hierzu gehören auch abwertende und diffamierende Worte über die Juden, findet man doch im islamistischen Antisemitismus häufig einschlägige Bezüge und Zitate. Bereits die Frühgeschichte des Islam war nach muslimischer Überlieferung dadurch geprägt, dass Mohammed zunächst zwar nur als Prophet, danach aber auch als Politiker und Feldherr auftrat. Hieraus leiten Islamisten die Notwendigkeit ab, Religion und Politik wieder zu vereinen, denn schon Mohammed habe diese Einheit postuliert. Auch in seiner Nachfolge wurden Eroberungskriege im Namen der Religion geführt, zunächst aus dem arabischen Raum, später dann über das Osmanische Reich bis nach Europa hinein. Sie gelten Islamisten als historisch-politischer Bestandteil ihres Islamverständnisses.
Merkmale des Islamismus
Merkmal I: Absolutsetzung des Islam als Lebens- und Staatsordnung
Worin bestehen nun die inhaltlichen Besonderheiten der politischen Bewegung des Islamismus? Als ein Merkmal kann die Absolutsetzung des Islam als Lebens- und Staatsordnung gelten. Jeder überzeugte Muslim wird in seiner Religion den für ihn wahren Glauben sehen und seine persönliche Lebensführung in gewissem Maße nach seiner Deutung des Islam ausrichten. Diese Auffassung hat, selbst wenn sie mit einem gewissen Exklusivanspruch auf die “einzig wahre Religion” einhergeht, nicht notwendigerweise etwas mit Islamismus zu tun. Erst wenn die gemeinte Absolutsetzung dieses Glaubens notwendiger Bestandteil für die Regelung des sozialen Miteinanders in einer Gesellschaft etwa im Sinne einer Rechts- oder Staatsordnung werden soll, kann von einer solchen politischen Ausrichtung gesprochen werden. Sie läuft in Kombination mit anderen Grundpositionen der Islamisten auf die Überwindung einer Trennung von Politik und Religion und die Etablierung eines islamischen Staates im theokratischen Sinne hinaus.
Merkmal II: Gottes- statt Volkssouveränität als Legitimationsbasis
In einem solchen politischen System bestünde die oberste Legitimationsbasis in einer Gottes‑, aber nicht in einer Volkssouveränität. Ausgangspunkt für eine solche Deutung ist folgende Erkenntnis: Da sich Gott nicht selbst äußern kann und die “Heiligen Schriften” unterschiedlicher Glaubensformen ambivalent und selektiv deutbar sind, kommt in einem solchen theokratischen Staat einer Minderheit von “Religionsgelehrten” die Aufgabe der einzig richtigen und rechtlich verbindlichen Deutung des jeweiligen Glaubens zu. Allein aufgrund dieser Tatsache läuft die Etablierung islamistischer Herrschaft auf ein diktatorisches System hinaus, das die behauptete Gottes- über die reale Volkssouveränität stellt. Diese Auffassung muss nicht für die rigorose Ablehnung von Wahlen stehen. Gleichwohl dürfen sich die Kandidaten oder Parteien in dieser Perspektive nur im eingeschränkten Rahmen des islamistischen Denkens bewegen, was unabhängige Bestrebungen ebenso wie eine politische Opposition ausschließt.
Merkmal III: Ganzheitliche Durchdringung und Steuerung der Gesellschaft
Ein solches Gesellschaftsmodell führt dazu, dass das politische und soziale Miteinander komplett durchdrungen und gesteuert wird. Aus der Auffassung “Der Islam ist die Lösung” — oder besser formuliert: “Die islamistische Deutung des Islam soll die Lösung sein” – folgt nicht nur die alleinige Ausrichtung des Staates in diesem Sinne. Hiermit würde auch die Ablehnung von Menschenrechten verbunden sein. Meinungs- und Religionsfreiheit für alle gäbe es schließlich in solch einem Staat nicht. Islamisten wollen, dass Staat, Recht und Gesellschaft total geprägt sind von ihrer Ideologie. In sozialen Kontexten mit islamistischer Hegemonie lässt sich dies etwa an der Indoktrination von Kindern ebenso wie an Kleidungsvorschriften für Frauen ablesen. Den “Religionsgelehrten” als angeblichen Sprechern der “Gottessouveränität” geht es nicht nur um die diktatorische Beherrschung, sondern auch um die politische Mobilisierung der Gesellschaft.
Merkmal IV: Homogene und identitäre Sozialordnung im Namen des Islam
Dies läuft auf eine homogene und identitäre Gesellschaftskonzeption hinaus, nach der sich alle Menschen in einer solchen Sozialordnung den politischen Vorgaben des “wahren Glaubens” zu unterwerfen haben. Den “Religionsgelehrten” kommt aus der Perspektive dieses kollektivistischen Denkens dann auch keine Bedeutung und kein Wert mehr als Einzelpersonen zu, sondern nur als Teil einer “Glaubensgemeinschaft”. In dieser Sicht muss die Ausrichtung von menschlichem Sozialverhalten auf Autonomie und Individualität als Abweichung vom Islam und demnach als schändlicher Ausdruck von Unmoral und Verderbnis gelten. Eine solche Auffassung schließt die Artikulation von Individual- und Partikularinteressen im Sinne eines gesellschaftlichen Pluralismus aus, denn es gibt in einer als authentisch islamisch geltenden Gesellschaft keine Differenzen zwischen Einzelnen und Gruppen. Gläubige und “Religionsgelehrte”, Regierte und Regierende bilden ein Kollektiv, das Individualität nur in begrenztem Maß zulässt.
Merkmal V: Frontstellung gegen den demokratischen Verfassungsstaat
Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich auch eine Frontstellung der Islamisten gegen die Normen und Regeln eines demokratischen Verfassungsstaates: Ihre Forderung nach einem islamischen Staat richtet sich gegen das Gebot einer Trennung von Politik und Religion. Historisch gesehen wurde das friedliche und gleichrangige Miteinander von Angehörigen unterschiedlicher Glaubensauffassungen dadurch aber erst möglich. Die Beschwörung einer Gottessouveränität – als entscheidende Instanz für Politik auf Basis der angeblich allein richtig interpretierten Botschaft des Glaubens – hebt das demokratische Grundprinzip der Volkssouveränität auf. Und da die Deutung des behaupteten einzig wahren Islam eine Gruppe von “Religionsgelehrten” übernehmen soll, eine selbsternannte Elite, läuft dies auf die Etablierung einer Diktatur durch einen Einzelnen oder eine Gruppe hinaus. Menschenrechte oder Pluralismus sind in dieser ideologisch und religiös homogen ausgerichteten Gesellschaft überflüssig.
Merkmal VI: Fanatismus und Gewaltbereitschaft als Potentiale
Die genannten islamistischen Grundpositionen müssen nicht mit der Bereitschaft zu Gewalt und Terrorismus einhergehen. Allerdings sind in diesem Denken Grundannahmen enthalten, die die Gewaltbereitschaft befördern. Hierzu gehört die rigorose Verdammung der bestehenden Gesellschaftsordnungen nicht nur in den westlichen Ländern. Aufgrund ihrer säkularen Ausrichtung gelten sie als Lebenswelt der Unmoral und “Zustände der Unwissenheit”. Da aber die Mehrheit der Muslime derartige politische und soziale Systeme akzeptiert und nicht die Notwendigkeit zu deren Ersetzung durch einen “Gottesstaat” fordert, sehen sich die Islamisten auch in der Frontstellung gegen diese Gläubigen. Als eine Art selbsternannte Elite wollen sie ihnen gegenüber die Alternative einer islamisch legitimierten Diktatur unbedingt durchsetzen. Fehlt ihnen die politische und soziale Unterstützung, greifen Islamisten dann unter Umständen zum Mittel der Gewalt.
Islamismus als hybride Kategorie
Wie kann man den Islamismus nun begrifflich und inhaltlich sinnvoll zuordnen? Im Vergleich mit anderen politischen Kategorien zeigen sich recht schnell Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede.
Extremismus
Unter Extremismus versteht man alle Auffassungen und Handlungen, die sich gegen die Minimalbedingungen eines demokratischen Verfassungsstaates richten. Bei dieser Zuordnung spielt eine inhaltliche Ausrichtung im Sinne einer bestimmten politischen Ideologie keine Rolle. Insofern kann es auch unterschiedliche Formen wie den Links- und Rechtsextremismus geben. Bei der Betrachtung der islamistischen Ideologie lassen sich zwar bezogen auf die jeweiligen Feindbilder (Israel, USA) und Strukturprinzipien (Antipluralismus, Kollektivismus) Gemeinsamkeiten ausmachen. Hinsichtlich der jeweiligen Prioritäten im Selbstverständnis dominieren aber Unterschiede zum Links- (Gleichheit) und Rechtsextremismus (Ethnie). Gleichwohl könnte man für den Islamismus durchaus von einem “islamischen Extremismus” oder “religiösen Extremismus” als weiterer Form sprechen.
Faschismus
Mitunter findet für den Islamismus auch in polemischer Absicht die Formulierung “grüner Faschismus” Verwendung: Bestimmte historische Erfahrungen wie etwa die Kooperation des Muftis von Jerusalem mit den Nationalsozialisten oder unterschiedliche Gemeinsamkeiten wie Antisemitismus oder Führer-Denken scheinen für diese Einschätzung auch gute Sachargumente zu liefern. Der Verfasser hält diese Einschätzung aber nicht für überzeugend: Beim Faschismus als politischer Bewegung der Zeit zwischen den 1920er und 1940er Jahren in Europa handelte es sich um ein ideologisch, organisatorisch und sozial ganz anderes Phänomen: Ethnische Gesichtspunkte spielen für den Islamismus kaum eine Rolle, während sie für den Faschismus von zentraler Bedeutung waren. Die letztgenannten Bewegungen definierten sich eher als säkular, wenngleich sie sich christlich-religiös geprägter Inhalte und Rituale bedienten. Demgegenüber stellt die Berufung auf den Islam, den Propheten und die Frühgeschichte der Religion den konstitutiven inhaltlichen Identitätsfaktor dar.
Fundamentalismus
Häufig findet bezogen auf den Islamismus auch die Formulierung “Fundamentalismus” Verwendung: Darunter versteht man in einem engeren Sinne religiöse Bewegungen, die sich auf eine wortwörtliche Auslegung ihrer “Heiligen Schriften” beziehen und eine Modernisierung des eigenen Glaubens rigoros ablehnen. In einem weiteren Sinne gilt der “Fundamentalismus” als eine Sammelbezeichnung für alle kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Auffassungen, welche sich nicht einer kritischen Prüfung ihrer Grundannahmen unterziehen wollen und argumentative Einwände mit Verweis auf die eigenen fundamentalen Werte negieren. Der Islamismus könnte sowohl im erst- wie im letztgenannten Sinne als eine Erscheinungsform des Fundamentalismus gelten. Umgekehrt sollte aber keine Gleichsetzung von “islamischem Fundamentalismus” und “Islamismus” erfolgen. Dem erstgenannten Bereich lassen sich auch orthodoxe Islamauffassungen ohne politische Aktivitäten zuordnen – womit ein konstitutives Merkmal von “Islamismus” fehlt.
Totalitarismus
Und schließlich wäre noch zu erörtern, inwieweit der Islamismus als eine neue Form des Totalitarismus gelten kann. Mit dieser Bezeichnung wird ein bestimmter Diktaturtyp begrifflich erfasst, der sich sowohl von einer liberalen Demokratie als auch von einer autoritären Diktatur unterscheiden lässt. Der zentrale Unterschied zum Letztgenannten besteht darin, dass es einer totalitären Diktatur um die breite Durchdringung der Gesellschaft geht und diktatorische Herrschaft demnach nicht nur auf Staatsfunktionen begrenzt wäre. Genau dies ist auch die Absicht von Islamisten, wollen sie doch selbst das Privatleben der Menschen in Richtung ihrer ideologischen Auffassungen steuern. Insofern wäre die Bezeichnung “totalitär” auf den Islamismus anwendbar, auch wenn der Begriff eigentlich als Terminus für die Staatsebene benutzt wird. Da es aber nur wenige islamistische Staaten und Systeme gibt, stellt die Anwendung des “Totalitarismus”-Begriffs ein Problem dar. Bezogen auf die Ideologie kann man durchaus von einer Erscheinungsform des “totalitären Denkens” sprechen.
Schlusswort und Zusammenfassung
Bei “Islamismus” geht es um eine Sammelbezeichnung für alle politischen Auffassungen und Handlungen, die im Namen des Islam die Errichtung einer religiös legitimierten Gesellschafts- und Staatsordnung anstreben. Islamisten bedienen sich unterschiedlicher Handlungsstile von der Parteipolitik über die Sozialarbeit bis zum Terrorismus. Ihnen allen sind verschiedene Merkmale eigen:
- Die Absolutsetzung des Islam als Lebens- und Staatsordnung.
- Der Vorrang der Gottes- vor der Volkssouveränität als Legitimationsbasis.
- Die angestrebte vollkommene Durchdringung und Steuerung der Gesellschaft.
- Die Forderung nach einer homogenen und identitären Sozialordnung im Namen des Islam und
- die Frontstellung gegen die Normen und Regeln des modernen demokratischen Verfassungsstaates.
Dies macht in der Bilanz aus dem Islamismus eine Form des religiösen Extremismus, ein Phänomen des politischen Fundamentalismus und eine Variante des ideologischen Totalitarismus.
Literatur
Ayubi, Nazih: Politischer Islam. Religion und Politik in der arabischen Welt, Freiburg 2002. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Islamismus, Berlin 2003.
Backes, Uwe/Jesse, Eckhard: Islamismus – Djihadismus – Totalitarismus – Extremismus, in: Uwe Backes/Eckhard Jesse (Hrsg.): Jahrbuch Extremismus / Demokratie Bd. 14, Baden-Baden 2002, S. 13–26.
Kepel, Gilles: Die Rache Gottes. Radikale Moslems, Christen und Juden auf dem Vormarsch, München 1991.
Kepel, Gilles: Das Schwarzbuch des Dschiahd. Aufstieg und Niedergang des Islamismus, München 2002.
Marty, Martin E./Appleby, R. Scott: Herausforderung Fundamentalismus. Radikale Christen, Moslems und Juden im Kampf gegen die Moderne, Frankfurt/M. 1991.
Meyer, Thomas: Was ist Fundamentalismus? Eine Einführung, Wiesbaden 2011.
Pfahl-Traughber, Armin: Die Islamismuskompatibilität des Islam. Anknüpfungspunkte in Basis und Geschichte der Religion, in: Aufklärung und Kritik, Sondeheft 13: Islamismus, 2007, S. 62–78.
Pfahl-Traughber, Armin: Islamismus als extremistisches und totalitäres Denken. Strukturmerkmale einer Ideologie der geschlossenen Gesellschaft, in: Aufklärung und Kritik, Sonderheft 13: Islamismus, 2007, S. 79–95.
Pfahl-Traughber, Armin: Islamismus – der neue Extremismus, Faschismus, Fundamentalismus und Totalitarismus? Eine Erörterung zu Angemessenheit und Erklärungskraft der Zuordnungen, in: Zeitschrift für Politik 55. Jg., Nr. 1/2008, S. 33–48.
Tibi, Bassam: Der neue Totalitarismus. “Heiliger Krieg” und westliche Sicherheit, Darmstadt 2004.
Lizenz

Dieser Text wurde in der Originalversion auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb.de) unter der Creative Commons Lizenz “CC BY-NC-ND 3.0 DE — Namensnennung — Nicht-kommerziell — Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland” veröffentlicht.